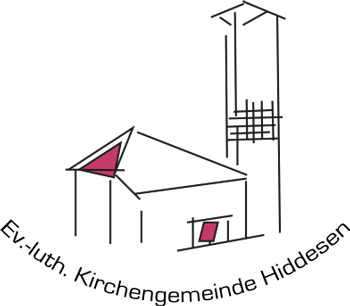Liebe Mitglieder der Gemeinde St. Michael im Kampe,
wir alle sind entsetzt über den Krieg in Europa. Die Menschen im Baltikum, die nahe an der russischen Grenze leben, sind es in besonderem Maße. Als Gemeindemitglied, das seit einiger Zeit in der estnischen Hauptstadt Tallinn lebt, bin ich gefragt worden einen kleinen Einblick zu geben, wie man hier im Baltikum auf den Krieg in der Ukraine reagiert. Ich meine, dass die Perspektive unserer osteuropäischen Verbündeten uns als Europäer und Deutsche etwas angeht, und dass wir von ihr lernen können.
Auch wenn wir sie alle kennen, rufe ich noch einmal die Fakten in Erinnerung. Am Morgen des 24. Februars 2022 wurde die Welt von der Nachricht erschüttert, dass russische Militäreinheiten in die Ukraine eingedrungen waren. In einer offenbar zuvor aufgezeichneten Fernsehansprache sprach der russische Präsident Wladimir Putin euphemistisch von einer „speziellen Militäroperation“, die darauf abziele, die Ukraine zu „entmilitarisieren“, zu „entnazifizieren“ und zu „neutralisieren“. Was nach Wochen und Monaten der militärischen Eskalation an der ukrainischen Grenze durch die Konzentration russischen Militärs im Norden, Osten und auf der okkupierten Halbinsel Krim aber faktisch geschah, war eine vollumfängliche militärische Invasion der Ukraine zu Land, zu Wasser, und aus der Luft.



Im ersten Moment schien die ganze Welt sprachlos angesichts der Ungeheuerlichkeit der Tatsache des Krieges, angesichts der Dreistigkeit der Lügen, mit denen Putin seinen Einmarsch rechtfertigte. Die osteuropäischen Staaten aber, so scheint es mir, waren schneller wieder im Besitz ihrer Sprache und Handlungsfähigkeit als der Rest der Welt. Hier, an der Außengrenze der EU zu Russland, war man schon länger in Alarmbereitschaft und hatte die Zeichen der Zeit eher erkannt als anderswo.
Beinahe im Handumdrehen wurden in Tallinn Solidaritätskundgebungen organisiert. Der 24.02., der Tag des Angriffs, ist in Estland Nationalfeiertag in Erinnerung an den 24. Februar 1918, an dem sich Estland in den Wirren des Ersten Weltkrieges für unabhängig erklärt hatte. Estnische Nationalflaggen wehten an diesem 24. Februar neben ukrainischen. Die Feier der eigenen staatlichen Unabhängigkeit verband sich nahtlos mit dem vehementen Eintritt für die staatliche Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine. Am Samstag, dem 26.02., demonstrierten auf dem Tallinner Freiheitsplatz Zehntausende für die Ukraine. Man ist sich einig, dass dies die größte Demonstration in der neueren Geschichte Estlands ist. Vertreterinnen der großen ukrainischen Diaspora traten ans Mikrofon, ebenso der estnische Präsident. Die Botschaft war immer die gleiche – der russische Angriff auf die souveräne Ukraine ist ein Angriff auf uns alle, auf die freiheitlich-demokratische Lebensordnung durch einen gefährlichen Despoten, und es muss alles getan werden, um dem entgegenzutreten.
Ein Blick ins baltisch-ukrainische Facebook-Universum. In der Gruppe „Ukrainer in Estland“ treffen alle paar Sekunden auf Ukrainisch Information ein, dass sich ein Bus mit freiwilligen Kämpfern dann und dann von Tallinn oder Pärnu aus in die Ukraine aufmache, es seien noch Plätze frei. Im nächsten Post gibt es ein Video von einer zerstörten russischen Panzerkolonne, dann von einem zerbombten Wohnhaus in der Mitte von Kyiv oder Charkiv, gefolgt von einer Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyj, dann Bilder einer Mutter, die mit ihren Kindern unter Tränen ihre zerbombte Wohnung verlässt. Videos von russischen Kriegsgefangenen, häufig junge, verschüchtert wirkende Männer, die nach Dienstgrad, Einheit, Name und Wohnort gefragt werden. Von der Zivilbevölkerung, wie sie russischen Okkupanten entgegentreten und auf sie einreden (auf Russisch), dass sie nach Hause gehen sollen zu ihrer Familie, und dass hier kein Bedarf an „Befreiung“ bestehe. Von Ukrainerinnen und Ukrainern, die sich mit ihren Körpern gegen einen russischen Panzer stemmen. Immer wieder werden in diesen Foren auch Bilder gefallener Soldaten und ziviler Opfer gezeigt.
An der Universität Tallinn, an der ich arbeite, kommt es schnell zu offiziellen Solidaritätsbekundungen. Rasch formiert sich eine Studierendenvereinigung unter dem Namen „Students with Ukraine“, noch am Folgetag der Aggression wird ein Zoom-Meeting einberufen, werden Ideen gesammelt, am nächsten Tag bereits Hilfsgüter sortiert und an die ukrainische Grenze verschickt.
Busse mit Hilfsgütern fahren an die polnisch-ukrainische Grenze und kommen mit Flüchtlingen zurück. Die sozialen Medien sind voller Hilfsaufrufe, landesweit werden freiwillige Helfer und Unterkunftsmöglichkeiten für Geflüchtete gesucht, es wird zur Unterschrift und Weiterleitung von Petitionen and die EU, die NATO, die nationalen Regierungen aufgerufen.
Solidarität erfährt die Ukraine, Gott sei Dank, in der gesamten demokratisch regierten Welt – von den riesigen Demonstrationen, von Fußballclubs, die auf russische Sponsoren verzichten, über die unglaublich schnelle Organisation von Hilfsgütertransporten, die Einrichtung von Spendenhotlines für die ukrainische Armee, die Vorbereitungsmaßnahmen für das Eintreffen ukrainischer Flüchtlinge bis hin zu Supermärkten, die russische Produkte aus ihren Regalen entfernen. Und doch ist die moralische und praktische Solidarität hier im Baltikum – und ich möchte betonen: in anderen ehemaligen Ostblockstaaten wie etwa Polen und Rumänien – noch einmal stärker und entschlossener, der Eintritt für die Ukraine noch kompromissloser.
Hier im Baltikum ist der Krieg nicht nur durch die geographische Nähe zu Russland näher und präsenter. Hier hatte man die Tragweite der völkerrechtswidrigen russischen Annexion der Krim 2014 und des von Russland befeuerten Krieges in der Ostukraine viel schneller erkannt als im Westen und die drohende Gefahr einer weiteren russischen Aggression niemals aus den Augen verloren. Das liegt daran, dass im kollektiven Gedächtnis der litauischen, lettischen und estnischen Gesellschaften die Erfahrungen mit dem Großmachtstreben größerer und mächtigerer Nachbarn noch frisch sind. Dazu bedarf es eines kleinen historischen Exkurses.
Das Zusatzprotokoll zum Nicht-Angriffspakt zwischen Hitler und Stalin vom August 1939, das eine Aufteilung Ostmitteleuropas in eine deutsche und sowjetische Einflusssphäre regelte, ist weit weg für uns Deutsche. In den Erinnerungskulturen des Baltikums hingegen ist es ein wichtiger negativer Bezugspunkt der eigenen Geschichte. Das Baltikum wurde damals dem sowjetischen Einflussgebiet zugeschlagen, geriet aber mit dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion 1941 unter deutsche Besatzung. Nach den Deportationen als „feindlich“ eingestufter „Elemente“ durch die Sowjets und nach der Ermordung der Juden durch die Deutschen wurde das Gebiet schließlich durch die Rote Armee zurückerobert. Doch die sowjetischen Befreier von der deutschen Okkupation blieben und wurden so selbst abermals zu Okkupanten. Die drei ehemals unabhängigen baltischen Staaten wurden zu Sowjetrepubliken, und auch nach dem Krieg rollten die sowjetischen Deportationszüge wieder. Am 23. August 1989, dem 50. Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes, formierte sich in der Atmosphäre der Gorbatschowschen Tauwetterpolitik eine Menschenkette durch die baltischen Hauptstädte Vilnius, Riga und Tallinn im Protest gegen die Okkupation. Bald darauf erlangten alle drei Staaten ihre Unabhängigkeit zurück, und die Sowjetunion zerfiel.
Alle drei Staaten sind inzwischen Teil der Europäischen Union. Sie sind es mit breiter Zustimmung der jeweiligen Bevölkerungen geworden, und mit ebenso breiter Zustimmung erfolgte die Aufnahme in das Verteidigungsbündnis der NATO. Aus Sicht dieser zahlenmäßig kleinen Gesellschaften – Litauen hat rund 2,8 Millionen, Lettland 1,9 Millionen, und Estland 1,3 Millionen Einwohner:innen – ist das Staatsräson: die Mitgliedschaft in der NATO bedeutet im Baltikum, an der Außengrenze der EU, einen Schutz gegenüber imperialen Ausdehnungsgelüsten des mächtigen östlichen Nachbarn. Nie wieder sollten militärisch überlegene Nachbarn einfach über das Schicksal der Litauer, Letten und Esten verfügen dürfen.
Auch die Ukraine hatte sich diesen Pfad der Westorientierung ab einem gewissen Zeitpunkt zum Vorbild genommen. Sie wollte dahin gelangen, wo die Ex-Sowjetrepubliken des Baltikums bereits angekommen waren. Wir erinnern uns, als der ukrainische Präsident Janukovyč das lang vorbereitete Assoziierungsabkommen mit der EU 2014 nach Druck aus Moskau nicht unterschrieb, gingen die Ukrainerinnen und Ukrainer auf die Straße. Der sog. Euromaidan aber rief Russland auf den Plan, das die Krim völkerrechtswidrig annektierte und die Separatistenbewegungen im Osten der Ukraine über Jahre hinweg militärisch und propagandistisch unterstützte.
Als ehemalige Opfer imperialistischer Aggressionen war man im Baltikum sensibilisiert für die Interessen der Ukraine und die Bedeutung ihres Überlebenskampes für ganz Europa. Und so blieb man auch in den Folgejahren der Aggression 2014, anders als in Westeuropa, in erhöhter Alarmbereitschaft, da die eigene Erinnerung an die imperialistische Großmachtpolitik anderer noch wach war und man den Preis der Freiheit kannte. Und so bereitete man sich auf das Schlimmste vor. Im Jahr 2015, als ich ein Jahr in Litauen verbrachte, gab die litauische Regierung Broschüren heraus, in denen Verhaltensratschläge für den Fall eines russischen Angriffs gegeben wurden. Man erinnerte sich an den antisowjetischen Kampf der sog. „Waldbrüder“, antisowjetischer Partisanen, die sich mitunter bis in die 1970er Jahre hinein im Wald versteckten und die sowjetischen Machthaber sabotierten. In den Wochenendseminaren an der Universität Vilnius, wo ich studierte, fehlten auf einmal Leute, da sie sich als Freiwillige einer militärischen Grundausbildung unterzogen. Die Angst, trotz NATO-Mitgliedschaft ebenfalls Opfer einer russischen Aggression zu werden, war von Litauen bis Estland überall zu spüren. Die konkrete Befürchtung war und ist, dass Putin im Baltikum einen Vorwand inszenieren würde, um dann den „Schutz“ der russischsprachigen Minderheiten vor allem in Lettland und Estland zum Vorwand für eine Aggression machen würde.
Deutschland kam aus Sicht des Baltikums in Sachen Sicherheit der östlichen NATO-Staaten eine Schlüsselrolle zu. Zwar sah man, dass es auch in Deutschland 2014 selbstverständlich Solidarität mit der Ukraine gab und auch die Warnungen der osteuropäischen NATO-Mitgliedstaaten vor weiteren Grenzverletzungen durch ein revisionistisch auftretendes Russland gehört wurden. Doch, zum Entsetzen unserer osteuropäischen EU-Partner, gab es auch eine mächtige Liga der sog. „Putin-Versteher“. Im Baltikum schüttelte man den Kopf über den Einfluss der Position, man müsse auf die russischen „Sicherheitsinteressen“ Rücksicht nehmen, denen die Osterweiterung der NATO angeblich entgegenstand. Diese Positionen stießen an der östlichen Außengrenze der EU auf großes Unverständnis: deutsches Verständnis für eine völkerrechtswidrige Annexion und für Putins revisionistische Rhetorik („die Krim war schon immer russisch“)? Verständnis für Argumente, die Hitlers Politik der Annexion des Sudetenlandes und des „Anschlusses“ Österreichs im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges legitimiert hatten? Mehr deutsches Verständnis für russische Sicherheitsinteressen gegenüber einem Defensivbündnis als für die Sicherheitsinteressen eigenständiger demokratischer Staaten gegenüber einem offen imperialistischen Russland? Das alles erinnerte stark an 1939. Denn auch damals sprachen Deutschland und die Sowjetunion über die Köpfe der Betroffenen – der Balten, Polen, Ukrainer, Belarussen, Rumänen etc. – hinweg.
Man sah mit Befremden, wie Deutschland gegenüber Putin oftmals Milde walten ließ unter Berufung auf die – natürlich tatsächlich bestehende – „historische Verantwortung“ gegenüber Russland angesichts der von den Deutschen im 2. Weltkrieg begangenen Gräuel. Aber was war mit der deutschen Verantwortung gegenüber anderen Opfergruppen? Spätestens jetzt rächte sich die falsche Gleichsetzung von „Russland“, dem Rechtsnachfolger der Sowjetunion, und der historischen „Sowjetunion“ im deutschen Diskurs, was ebenso zu einer Gleichsetzung „sowjetischer“ und „russischer“ Opfer des deutschen Vernichtungsfeldzuges im Osten überhaupt geführt hatte. Aber nicht alle sowjetischen Opfer waren Russen. So geriet die Anerkennung des Leides der Belarussen, der Ukrainer, der Litauer, Letten und vieler anderer unter nationalsozialistischer Besatzung in Deutschland aus dem Blickfeld, und damit ebenso die daraus folgende Verantwortung Deutschlands auch für die Nachfahren dieser Opfer.
Diese Unterrepräsentanz der Leiden anderer Nationen und Volksgruppen in der deutschen Erinnerungskultur ist auch in Deutschland selbst angekreidet worden. Im Zuge der Ukrainekrise wurde darauf aufmerksam gemacht, dass insbesondere die Territorien der ehemaligen ukrainischen Sowjetrepublik zu denjenigen gehörten, die der amerikanische Historiker Timothy Snyder als „bloodlands“ bezeichnet hat. Denn hier kreuzten sich im 20. Jahrhundert zwei unheilvolle imperiale Projekte – das der Nazis, die ihren Eroberungs- und Vernichtungsfeldzug mit der Gewinnung von „Lebensraum im Osten“ und insbesondere der „ukrainischen Kornkammer“ begründeten, und das sowjetische Projekt Stalins. Und so wurde die Ukraine nach der künstlich von Stalin Anfang der 1930er Jahre heraufbeschworenen Hungersnot, in der Ukraine als „Hungertod“ (Holodomor) erinnert, im Zuge des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion 1941 auch noch zur Stätte des Holocausts und der Vernichtungspolitik gegenüber „slawischen Untermenschen“, was Millionen Menschen das Leben kostete.
All dies aber wurde in Deutschland, wenn man Milde gegenüber Putin mit der „historischen Verantwortung gegenüber Russland“ begründete, oftmals nicht mitgedacht. Es ist für die Balten wie auch Ukrainer, Belarussen etc. aber ungemein wichtig, dass wir in Deutschland diese Geschichten kennen und diese Zusammenhänge besser verstehen. Deutschland hat, das ist die Botschaft, nicht nur historisch begründete Verantwortung gegenüber den Russen, sondern ebenso gegenüber den Ukrainern, Belarussen, Letten, Litauern und Esten, und natürlich in besonderem Maße gegenüber den jüdischen Nachfahren der Opfer der Shoah. Und diese Verantwortung wird heute insbesondere in Fragen der Sicherheit eingefordert.
Daher wird in diesen Tagen die außenpolitische Kehrtwende der Bundesregierung nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine hier als längst überfällig begrüßt, und man nimmt es mit Erleichterung auf, dass Deutschland nicht, wie etwa von Friedrich Merz befürchtet, zum „Bremser“ einer entschlossenen westlichen Antwort auf die russische Aggression geworden ist, sondern die Sanktionen mitträgt. Die erklärte Absicht, die Bundeswehr wieder verteidigungsbereit zu machen, und die demonstrative Bekräftigung der eigenen Verantwortung im Rahmen der NATO, etwa die Entscheidung, weitere deutsche Soldaten in Litauen zu stationieren, wird hier sehr positiv bewertet. Denn das sind die Signale der Solidarität mit den östlichen Partnern, die man sich hier wünscht.
Niemand weiß, wie dieser Krieg ausgehen wird. Aber erlauben Sie mir zum Schluss noch eine persönliche Einschätzung. Putin hat das Gegenteil dessen erreicht, was er wollte: weder ist es ihm gelungen, den durch seine Aggression fester denn je zusammenstehenden „Westen“ nach alter Manier zu spalten, noch nimmt ihm die Weltöffentlichkeit länger seine aberwitzigen Lügen ab, noch wird er sein Ziel erreichen, den selbstgewählten europäischen Kurs der Ukraine mit Gewalt zu verhindern. Denn darum geht es ihm: es darf keinen erfolgreichen, modernen, nicht despotisch regierten und sich erfolgreich europäisierenden post-sowjetischen ukrainischen Nachbarstaat geben. Dieses Vorbild würde das autokratische System Putin mitsamt dem Reformstau, der versäumten Modernisierung der Wirtschaft und der Unterdrückung der demokratischen Opposition nach innen restlos delegitimieren. Das ist Putins größte Angst. Und so kommt es zu dem grotesken Schauspiel, dass er dem demokratisch gewählten ukrainischen Präsidenten mit jüdischen Wurzeln und russischer Muttersprache vorwirft, ein „drogenabhängiger“ „Faschist“ zu sein, der einen „Genozid“ an ethnischen Russen in der Ukraine ausübe, weshalb die Ukraine „entmilitarisiert“ und „denazifiziert“ werden müsse – während wir die Nachricht erhalten, die Gedenkstätte Babyn Jar, eine Schaustätte des Holocausts in der Ukraine, sei von der russischen Aggression betroffen.
Putins Taktik, innenpolitische Legitimation durch imperialistisches Großmachtstreben nach außen zu kompensieren, kann und darf nicht aufgehen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer ringen uns in diesem existenziellen Kampf für ihre Unabhängigkeit den allerhöchsten Respekt für ihren Mut und ihre Tapferkeit ab. Es ist keine floskelhafte Theatralik in der Auffassung, dass in der Ukraine die Freiheit Europas verteidigt wird. Das haben die Menschen am östlichen Rand der EU, deren Perspektive ich hier zu schildern versuche, früher verstanden, und umso wichtiger ist es, dass wir in Deutschland zuhören und helfen. „Denn Mitschuld trägt, wer unter Sündern schweigt.“ (Mihály Babits)
Wie kann man die Ukraine unterstützen?
Es gibt eine Zusammenstellung der Möglichkeiten für humanitäre Hilfe auf der liberalen Plattform „Ukraine verstehen“:
https://ukraineverstehen.de/unterstuetzung-fuer-die-ukraine/
Zum Anbieten von Unterkünften:
https://unterkunft-ukraine.de/?fbclid=IwAR1boUVf61zCoByjV5FD6bDQLroREi83QQWCpTzYcracFKVoujuNV4T5qO8
Über den Verein „Ukraine-Hilfe Berlin e.V.“ kann man Geld spenden, und es gibt eine aktualisierte Liste benötigter Sachspenden:
https://www.ukraine-hilfe-berlin.de/mithelfen/
Auf der Webseite „standforukraine.com“ wird eine Vielzahl von Spendenmöglichkeiten aufgezählt:
https://standforukraine.com/
Spenden kann man auch über die Seite des Ukrainischen Roten Kreuzes:
https://redcross.org.ua/
Lokal gibt es eine Seite des Kreises Lippe mit Informationen dazu, wie man helfen kann:
https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe/aktuelles/ukraine-aktuelle-lage.php
Aus ARD und ZDF bekannt sind zudem „Bündnis Entwicklung Hilft“ und „Aktion Deutschland Hilft“:
„Bündnis Entwicklung Hilft“ und „Aktion Deutschland Hilft“
BEH und ADH
IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600
BIC: COBADEFFXXX
Commerzbank
Stichwort: ARD/ Nothilfe Ukraine
www.spendenkonto-nothilfe.de
Der Krieg in der Ukraine – Einblicke vom östlichen Rand der Europäischen Union
Johannes Bent, Tallin